Wie der Ruf nach digitaler Effizienz an maroden Strukturen, Fachkräftemangel und ökologischen Widersprüchen scheitert:
„Die künstliche Intelligenz wird die Papierberge in den Ämtern beseitigen und die Verwaltung effizienter machen“ – mit dieser Vision werben Politik und Industrie seit Monaten für den Einsatz von KI-Systemen im öffentlichen Sektor. SAP, Microsoft und OpenAI kündigten im Herbst 2025 eine „souveräne KI für Deutschland“ an, die Behörden künftig beim Verarbeiten von Dokumenten, bei Anträgen oder Bürgerkommunikation unterstützen soll.
Doch die Realität in vielen Kommunal- und Landesverwaltungen sieht anders aus: marode IT-Infrastruktur, uneinheitliche Softwarelandschaften, Fachkräftemangel und organisatorische Überforderung prägen den Alltag. Zwischen Digitalversprechen und Verwaltungswirklichkeit klafft eine wachsende Lücke.
Politischer Druck: Digitalisierung bis 2026
Mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) ist seit 2017 gesetzlich vorgeschrieben, dass Bund, Länder und Kommunen ihre Verwaltungsleistungen bis Ende 2026 digital anbieten müssen.
Die Bundesregierung bezeichnet diese Frist als „zentralen Baustein der Verwaltungsmodernisierung“. Doch laut einer Untersuchung des Nationalen Normenkontrollrats (NKR) sind weniger als 30 Prozent der Leistungen vollständig digital umgesetzt – und die meisten davon nur oberflächlich.
In zahlreichen Fachanalysen heißt es, die Verwaltung neige dazu, analoge Prozesse einfach zu digital verlängern, anstatt sie neu zu gestalten – so der Tenor mehrerer Studien. Digitalisierung werde häufig als technisches Projekt verstanden, nicht als organisatorische Transformation.
Strukturelle Realität: Chaos in Daten und Zuständigkeiten
Viele Verwaltungen verfügen bis heute nicht über zentrale Datenmanagementsysteme. Informationen liegen verstreut in Netzlaufwerken, Excel-Listen oder PDF-Akten. Unterschiedliche Fachverfahren sind nicht kompatibel, Schnittstellen fehlen oder sind zu teuer.
Hinzu kommt: In vielen IT-Abteilungen arbeiten Quereinsteiger oder Beschäftigte mit geringer technischer Qualifikation – oft aufgrund von Personalmangel oder niedrigen Gehältern. Der Bundesrechnungshof kritisierte 2024, dass „IT-Projekte häufig an mangelnder Qualifikation der Projektverantwortlichen scheitern“.
Auch Fachleute des Fraunhofer-Instituts FOKUS weisen darauf hin, dass Digitalisierung bestehender Probleme diese nicht automatisch löst – so der Tenor der Diskussion. Oft werde Chaos lediglich digitalisiert, statt beseitigt.
Der sogenannte Fachkräftemangel – ein strukturelles Problem
In der öffentlichen Diskussion ist häufig vom „Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst“ die Rede. Doch der Begriff greift zu kurz – er verschleiert, dass der Engpass nicht durch fehlende Menschen, sondern durch fehlende Mittel, starre Strukturen und unattraktive Rahmenbedingungen entsteht.
Fehlende Mittel statt fehlender Menschen
Viele Verwaltungen dürfen schlicht nicht einstellen, obwohl qualifizierte Bewerber vorhanden wären.
Haushaltssperren, Personalstopps und starre Stellenpläne verhindern Neueinstellungen selbst dann, wenn Bedarf besteht.
Der Mangel an Personal ist daher hausgemacht – er entsteht durch politische und finanzielle Restriktionen, nicht durch fehlende Fachleute.
„Es geht um nicht weniger als die Frage, ob der öffentliche Sektor seine Kernaufgaben in Zukunft noch erfüllen kann“, sagte Volker Halsch, Senior Advisor bei PwC. (Quelle: PwC, 2024)
Fehlende Attraktivität und Bezahlung
Gerade in digitalen Berufen ist der Staat kein konkurrenzfähiger Arbeitgeber.
Tarifliche Einstufungen nach TVöD oder Landesbesoldungssystemen lassen wenig Spielraum, um Expertise marktgerecht zu vergüten.
Ein erfahrener IT-Architekt verdient in der Privatwirtschaft oft das Doppelte einer vergleichbaren Position in der Verwaltung.
„Bei der Digitalisierung von Verwaltungen und Kommunen brauchen wir mehr Klarheit: Wer bestellt, zahlt – und stellt digital bereit. Der Bund muss die Möglichkeit erhalten, Städte, Gemeinden und Landkreise bei der Digitalisierung direkt zu unterstützen“, forderte Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst. (Quelle: Bitkom, 2025)
Strukturelle und kulturelle Barrieren
Selbst wenn Fachkräfte gewonnen werden, bleiben sie häufig nicht lange. Fehlende Entwicklungsperspektiven, hierarchische Strukturen und mangelnde Entscheidungsfreiheit wirken abschreckend.
„Wer die Verwaltung digitalisieren will, muss sie verstehen. Aber der Staat kann nicht voraussetzen, dass alle, die programmieren können, sich dauerhaft in veralteten Strukturen wohlfühlen“, so Morris Hültner, Projektleiter bei Staatklar. (Quelle: staatklar.org, 2025)
Der sogenannte Fachkräftemangel ist daher kein naturgegebenes Problem, sondern eine Folge politischer und struktureller Fehlsteuerung. Es mangelt nicht an Know-how, sondern an Freiräumen, Finanzierung und Wertschätzung.
Abhängigkeit von Technologiekonzernen
Besonders problematisch ist die zunehmende Abhängigkeit öffentlicher Institutionen von großen Technologiekonzernen. Microsoft, SAP, Amazon und OpenAI dominieren den Markt – auch in der Verwaltung. Selbst vermeintlich „souveräne“ Lösungen basieren meist auf deren Cloud-Infrastrukturen.
Das widerspricht dem politischen Anspruch digitaler Eigenständigkeit. Zwar sollen Projekte wie „Sovereign Cloud Germany“ Datensouveränität sichern, doch die technologische Basis bleibt US-kontrolliert. Der CLOUD Act erlaubt US-Behörden den Zugriff auf Daten amerikanischer Anbieter – auch, wenn diese in Deutschland gespeichert sind.
Die Stiftung Neue Verantwortung warnt in diesem Zusammenhang vor einer „Privatisierung der digitalen Verwaltung“: Wenn zentrale Infrastrukturen und Daten in privaten Händen liegen, verliere der Staat seine digitale Souveränität – so der Tenor der Analyse.
„Digitale Souveränität ist das digitalpolitische Buzzword der Stunde. Der Begriff ist Ausdruck der Sorge, dass die digitale Transformation die staatliche und individuelle Selbstbestimmung bedroht“, schreibt Julia Pohle in ihrer Analyse. (Quelle: netzpolitik.org, 2021)
Der ökologische Widerspruch
Während Bund und Länder mit Gesetzen wie dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) oder der Klimaschutzverordnung Energieeinsparung und Nachhaltigkeit gesetzlich einfordern, ist die eingesetzte KI-Technologie selbst ein massiver Ressourcenverbraucher.
Laut einer Studie der University of California (2023) verbraucht eine einzelne ChatGPT-Abfrage im Schnitt rund 500 ml Wasser, indirekt durch die Kühlung der Rechenzentren. Das Training großer Modelle wie GPT-4 benötigt mehr Strom als 1.000 Haushalte pro Jahr.
Der Nature Climate Change Report (2024) prognostiziert, dass KI-Systeme bis 2030 rund vier Prozent des weltweiten Strombedarfs verursachen könnten.
Kritiker sehen darin einen erheblichen Widerspruch: Eine Verwaltung, die CO₂-Bilanzen und Energieausweise fordert, nutzt gleichzeitig Technologien, deren ökologischer Fußabdruck kaum bilanziert oder transparent gemacht wird.
Kommunikative Luftblasen statt realer Transformation
Politisch ist die KI-Rhetorik attraktiv: Sie klingt modern, innovationsfreudig und lösungsorientiert. Doch solange grundlegende Strukturen – Datenarchitektur, Personalqualifikation, Zuständigkeiten und Finanzierung – nicht verändert werden, bleibt der Effekt oberflächlich.
Fachleute warnen, dass KI keine schlechten Prozesse reparieren kann, sondern sie höchstens beschleunigt – so der Tenor in vielen Fachkreisen.
KI kann nur dort sinnvoll wirken, wo Prozesse klar definiert, digital anschlussfähig und organisatorisch verstanden sind.
Fazit
Die Vision einer intelligenten, papierlosen Verwaltung ist verführerisch – und grundsätzlich richtig. Doch sie kann nur Realität werden, wenn die politischen und organisatorischen Grundlagen stimmen:
- einheitliche Datenstandards,
- qualifiziertes Personal,
- nachhaltige IT-Strategien,
- und echte digitale Souveränität.
Ohne das bleibt KI in der Verwaltung eine technologische Fassade über strukturellem Stillstand – ein Fortschritt, der sich fortschrittlich anhört, aber nicht nachhaltig trägt.
Quellen & weiterführende Literatur
- PwC Deutschland: Digitalisierung der Landesverwaltung in Deutschland (2023)
- Bundesrechnungshof: IT und Digitalisierung in der Bundesverwaltung (2024)
- Bitkom: Kommunale Digitalisierung 2023
- Fraunhofer FOKUS: eGovernment Monitor 2022
- Nature Climate Change (2024): Energy and Water Costs of AI Systems
- University of California (2023): The Hidden Water Footprint of Large AI Models
- Stiftung Neue Verantwortung (2024): Digitale Souveränität im öffentlichen Sektor
- netzpolitik.org (2021): Digitale Souveränität. Das Ringen um Handlungs- und Entscheidungsfreiheit im Netz
- staatklar.org (2025): IT-Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst
- Bitkom (2025): Bund-Kommunen-Digitalisierung Pressemitteilung
- PwC (2024): Fachkräftemangel im öffentlichen Sektor


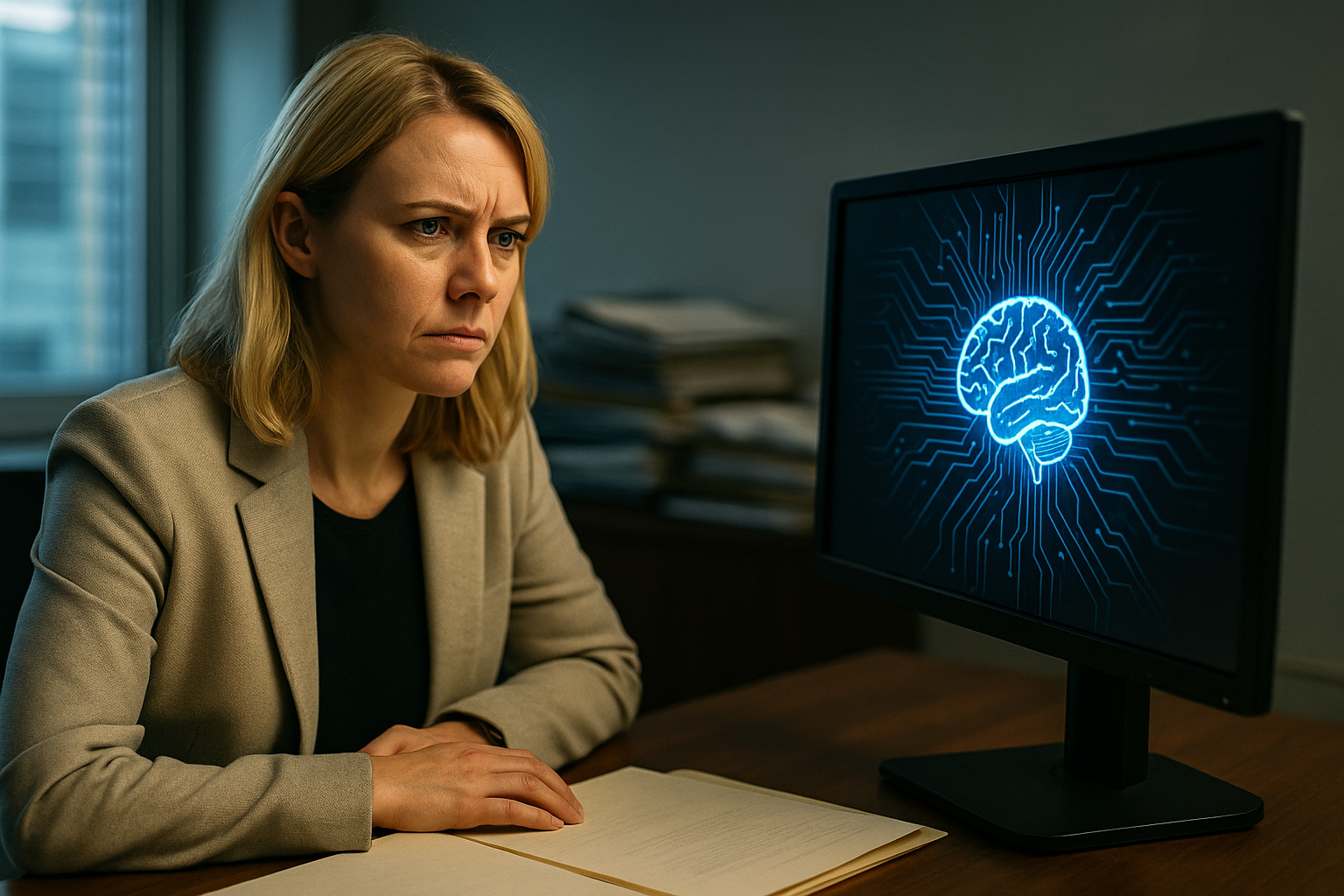
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.